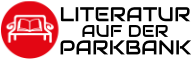Foto © Marina Delzer
Roland Schulz – Journalist und Diplom-Forstwirt
Geboren am 10. 08. 1960 in Crailsheim
Verheiratet mit Marina Delzer seit 21. Juni 1994
Arbeitsleben ab 2002
seit April 2018 freier Journalist, Buchautor, Naturführer
Juli 2007 – März 2017 Leiter Presse Naturwacht Brandenburg
Seit April 2002 Freiberuflicher Journalist
weiterlesen
Preise
2016 Ehm-Welk-Literaturpreis des Landkreises Uckermark
2021 Brandenburger Dialoge – Preis des Hans-Otto Theaters, Potsdam
2022 Godesberger Literaturpreis
2023 Fränkischer Kurzgeschichtenpreis – Anthologie
Leseprobe
Der goldene Klang
Es mag zwei Jahre her sein, als der Landstreicher durch die Uckermark zog. Heute taucht er hier auf, morgen dort, übermorgen bleibt er verschwunden.
Landstreicher, aus der Norm geflüchtete Menschen, leben nach eigenen Regeln. Das macht sie verdächtig. Und: Interessant!
In alten Zeiten klopften sie an Türen, baten um eine Scheibe Brot. Hackten für eine Mahlzeit Holz, halfen bei der Ernte, bauten die Scheune mit und brachten den Dörflern in ihr abgeschiedenes Dasein bunte Geschichten aus aller Welt. Bis sie über Nacht verschwunden waren. Keiner, der gefragt hätte.
Als Kind erinnere ich mich an meine Achtung vor Landstreichern. Waren sie doch, so bewies schon ihr Name, für sämtliche Farben im Leben zuständig. In jedem Frühjahr auf´s Neue strichen sie das Land in Grüntönen, schenkten Obstbäume summende Blütenträume, tupften blau-gelb-weiße Krokusmeere unter wankelmütige Frühlingshimmel, gossen Tulpenfelder über Nacht in leuchtendes Rot.
Einst hatten alle Winter hatten weiß zu sein. Ein, zwei Mal der volle weiße Farbeimer darüber und es war gut. Junge, die nicht schlummern konnten, die weiter malen, immer nur malen wollten, zogen über die weißen Berge in den Süden. So einfach war das.So war meine Kinderwelt und so konnte es mich nicht verwundern, als mir der Lindenbaum in seinem Blätterrauschen die Geschichte von einem besonderen Landstreicher erzählt hat. Dem mit dem goldenen Klang.
Der war, wie die Linde sich erinnerte, ein dürrer drahtiger Mann, der verschiedentlich Menschenkindern, erschienen war. Wenigstens, wollte man den Alten glauben. Dieser hochgeschossene Landstreicher mit wirr blondem Haarschopf hatte die Eigenart, aus dem Nichts zu erscheinen und zwischen einem der nächsten Augenblicke wieder spurlos im Nichts verschwunden zu sein.
Bei jeder Begegnung glaubten die Menschen ein goldenes Blinken zu erhaschen, einen goldenen Klang zu erlauschen und es schien ihnen, als sähen sie einen hitzeflimmernden schlanken alterslosen Mann. Ein kurzes Augenblinzeln, um das vermeintliche Trugbild zu schärfen, und alles war, als ob es diese Begegnung nie gegeben hätte.
Kein hagerer Kerl mehr, kein Blitzen, kein verwehter Klang, nur die Geräusche des Alltags. Hitzestreich der Fantasie?Dieser Landstreicher zog von Beginn an durch die Welt. Grenzen galten für ihn nicht. Wenn er nach Norden wollte, zog er nach Norden und ging es nach Süden, zog seine Spur nach Süden.
Ohne zu planen, zu packen, ohne Landkarten, ohne Gepäck, ohne Geld.
In einigen Ländern leben noch Menschen, die sich an ihn erinnern. Der ein oder andere glücklich, wenn er für sein Erlebnis offene Ohren findet. Andere trauen sich selbst nicht mehr und schweigen.In dem ersten Land war der Landstreicher goldener Ritter, im anderen Sonnentänzer, im dritten als Meistersänger bekannt. Alle Geschichten verbunden durch den goldenen Klang. Eine Gabe, die er freizügig teilte. Todsicher traf sein goldener Ton jedes Herz, ließ es schwingen und hatte Kraft, das Beste im Menschen zu wecken. Das Beste, das bei jedem Menschen anders ist und doch bei allen Menschen gleich. Doch nur, wenn der Beschenkte diese Gabe annahm, hütete wie das Herdfeuer, klang dieser Ton in ihm weiter.Im Moment, in dem der Landstreicher auftauchte, war er wieder verschwunden, urplötzlich, vom Boden verschluckt. Zurück blieb eine durchsichtige in den Staub gewebte Erinnerung. Und dieser goldene Klang, glänzend, der Herzen anrührte, tiefe Freude in Gesichter schrieb.
Bei wenigen schwang dieser Ton fortan ein ganzes Leben im Herzen. Bei anderen war er nach der ersten Stunde verstummt. Menschen, die den goldenen Klang erlauscht, verloren hatten, litten zeitlebens darunter. Einen Verlust, den sie nicht benennen, einordnen konnten. Da war nur diese unbenennbare Sehnsucht, die sie ins Nichts treiben wollte.
Hätte man die Lebenslinien aller Menschen, die vom goldenen Klang berührt wurden, auf einer Lebenskarte eingezeichnet, ähnlich einer Landkarte, dann hätte der Zeichner im Moment der Begegnung mit dem Landstreicher von einem grauen Stift zu einem goldfarbenen gewechselt.
Manchmal wäre der Strich für eine Zeitlang gülden geblieben, dann verblasst, in Grau versunken, als hätte er nie geleuchtet. Seltener strahlte die Lebenslinie in stetig glänzendem Gold, endete golden im Tod. Das waren die Glückskinder.
Doch diese sind rar und Landstreicher, die früher zum selbstverständlichen Leben in den Dörfern gehörten, fielen wie Schwalben, Störche, Pfützen auf Erdwegen oder der sonntägliche Kirchgang zunehmend aus der Zeit. Von vielen wenig bemerkt.Bereits vor 50, 60 Jahren erschien der hagere Landstreicher seltener. In einem blond wogenden Kornfeld, einem im Fenster zwinkernden Sonnenstrahl, in hustender Staubwolke hinter pflügendem Ochsengespann.
Vor hundert, zweihundert Jahren, war das anders gewesen. Der Streicher zeigte sich dem Bauern beim abendlichen Gang über den Hof, dem geschwätzigen Melker beim Dorfklatsch, dem Schäfer beim Hüten, dem Bankdirektor beim Geld verleihen, der Magd beim Getreide binden.
Plötzlich stand er da, sprach keck sein Gegenüber an, ließ zwei Worte über das Wetter fallen, die Ernte, bat um einen Schluck Wasser, ein Kanten trocken Brot, fragte nach dem Weg, verschenkte leichthin sein hallendes Gott zum Gruß und war wie ein spielender Windhauch leise raschelnd im hohen Gras verschwunden.Einmal war er dem Bürgermeister eines ansehnlichen Dorfes, fast schon einer kleinen Stadt, erschienen. Auf steinerner Brücke, die den größten Fluss des Landes überspannte, in einer Vollmondnacht.
Quälende Gedanken an Amtsgeschäfte hatten ihm wohl den Schlaf geraubt. So hatte er sich angekleidet, um in der ruhigen Nacht Müdigkeit zu suchen, die schmale Pforte in den Schlaf. Just als er sich über die steinerne Brüstung der Brücke legte und tief seufzte, diesen tiefen Drang zum Sprung fühlte, traf ihn eine Spiegelung, der Vollmond spielte im Fluss und neben ihm lehnte aus dem Nichts der Landstreicher.
Ohne Worte, ohne Zeit für Erschrecken, traf ihn der goldene Klang. Seine Augen strahlten, sein Herz war leicht wie seit Kinderzeiten nicht mehr und gerade, als er den Fremden ansprechen wollte, wurde sein Blick vom silbernen Mondglitzern im Fluss gefangen. Danach war es wie zuvor, allein lehnte er an der Brüstung. War nicht sicher, ob alles nur ein Traum war.
Doch der Klang in ihm war da, hielt an, verschenkte seinen Zauber. Beim Nachhausegehen grübelte er, was das nun gewesen sein könnte. Da fiel ihm seine Großmutter ein, die diese Geschichte erzählt hatte, wieder und wieder. Erschöpft und aufgewühlt, glücklich dabei, erreichte er sein Haus, fiel ins Bett. Morgen, ausgeschlafen, erfrischt, würde er dieser Sache auf den Grund gehen.
Den nächsten Morgen, den ganzen Tag und die Tage darauf wirkte er frei von aller Last, scherzte und alle, die ihn trafen, wunderten sich über seine Leichtigkeit. Hinter seinem Rücken tuschelten sie, ob er wohl in einen Jungbrunnen gefallen wäre, ob er Glück im Spiel gehabt hätte oder vielleicht sogar eine heimliche Liebschaft pflegte. Doch nichts von alledem traf zu. Der Bürgermeister wollte der Sache auf den Grund gehen, immer am nächsten Tag, wenn er einmal Zeit finden würde. So verlor sich der Ton langsam in ihm und starb.
In Nächten, wenn Sorgen und Schlaflosigkeit ihn plagten, zog es ihn magisch zur Brücke und er wünschte sich wie nichts auf der Welt eine zweite Begegnung mit dem Landstreicher, mit dem Ton, der sein Herz für eine Weile berührt hatte. Bis eines Nachts auch dieser Wunsch verklungen war.
Es mag vor zwei Jahren gewesen sein, als der Landstreicher wieder durch die Uckermark zog.
Dabei muss er der Karde begegnet sein. Der wilden Karde, so nannten Menschen in einem Dorf zwischen dem großen See im Osten und Endmoränenhügeln im Westen, die neue fremde Frau.
Vor einigen Jahren hatte sie, vielleicht 40, 45 Jahre alt, ein herunter gekommenes Haus, ein gut Stück vom Dorf entfernt, für wenig Geld erworben. Hatte das Dach ausbessern lassen, Fenster ausgetauscht, verfaulte Staken im Gartenzaun ersetzt.
Kaum notdürftig geflickt, war sie gemeinsam mit Schafen, Hühnern, sieben Völkern Bienen, drei Katzen und einer Schar junger Gänse eingezogen. Zwölf, um genau zu sein.
Hier noch noch eine Mauerlücke verfugt, dort einen Apfelbaum gepflanzt und jeden Feldstein, den sie finden konnte, auf einen wilden Platz im Garteneck unter den Holunder gelegt. Kaum ein Gang mit ihrer Gänseschar, von dem sie nicht wenigstens einen dieser bunten Granite in ihren Duftgarten trug.
Die Karde lebte bescheiden. Einzig für ihren Duftgarten machte sie eine Ausnahme, reiste jedes Frühjahr für zwei Tage in die Stadt, zur Gärtnerei zwischen Häusern und Land. Kehrte erwartungsvoll zurück, in jeder Hand einen tiefbraun geflochtenen Weidenkorb, über dessen Rand in Zeitungspapier verpackte Pflänzchen lugten. Sprach mit dem Boden, brachte sie an passenden Plätzen in die Erde und konnte kaum erwarten, bis es losging, das Blühen begann, ihr Duft die Insekten rief.
Damaszener Schwarzkümmel, Weinraute, Muskateller Salbei, Eisenhut, Moossteinbrech und viele mehr mischten aus schwerblütigen Ölen, flüchtigen Parfümspuren oder gewöhnlichem Honigsüß ständig neue Noten in die Luft. Die meisten Blüten vermischen ganze Sommertage und der große Rest experimentiert durch die Nacht. Und gerade, wenn der Garten den absoluten Duft gefunden glaubt, diesen Geruch nur halten muss, pustet irgendeine andere Blüte beglückt ihre Note in die Luft und das Mischen geht weiter.
Jedes Mal, wenn die Karde im Garten war, saugte sie diese Blütengeschenke tief ein. Beugte sich zu kleinen verborgenen Blüten des Gänsefingerkrauts, streckte sich zum Jelängerjelieber oder genoss am Steinhaufen sitzend flüchtige Kleenoten.
Schmetterlinge kehrten ein, klebten ihre Eier im Verborgenen, Raupen kosteten, Spinnen spannen. Und wenn sich einmal ein Ritterfalter, ein Schwalbenschwanz einstellte, feierte der ganze Garten diesen „hohen Besuch“.
Im Garten der Karde blieb immer Platz für Blindschleiche, Igel und Maulwurf. Einmal hatte die Tigerkatze gebannt auf einen Punkt vor sich auf dem Boden des Hofes gestarrt, beide Ohren gespitzt. Die Karde wunderte sich, kam hinzu und wenige Momente später schob sich ein schwarzer Samtpelz mit spitzer Schnauze heraus, wuselte ein, zwei Meter weiter, schaufelte wild mit den Spatenpfoten los, war im Nu wieder in seiner Unterwelt verschwunden.
Tigerkatze und Karde verblüfft hinter sich lassend. Erstarrte Beobachter. Erst danach fand die Karde das Wort: Maulwurf. Was er wohl bei seinem gefährlichen Ausflug in der Oberwelt gesucht haben mag?
In all der Pracht und Zufriedenheit hatte sich der Juni auf den Kalender geblättert. Der Lieblingsmonat der Frau. Vorsichtig schlich sie an jedem Vormittag tief gebückt im Schutz der Johannisbeersträucher Zentimeter für Zentimeter an den Kompost. Ganz langsam, viel langsamer als in Zeitlupe, hob dort ihren Kopf und spähte durch das lockere Blattmosaik der Himbeersträucher.
Wie still sie sich freute, wenn sie dort eine schwarze oder graue, selten einmal eine grün schimmernde Königin erspähte, die sich dort in der Sonne räkelte und wärmende Strahlen sammelte. Zwei oder drei intensive Blicke und danach, jede Bewegung in Behutsamkeit gehüllt, zurück. Noch langsamer.
Gut war es, wenn sie keine der Ringelnattern mit ihren gelben Krönchen, ihren Tigerstreifen an den Wangen, ihren abgrundlos scheinenden Knopfaugen, gestört hatte. Sie würden, das wusste die Karde aus dem vergangenen Jahr, bis Ende Juli hier Sonne tanken, dicker werden und im beginnenden August ihre Pergamenteier, vielleicht 20, in den vorgeheizten Kompost legen. Die Schlangen würden weiter reisen und Karde könnte nun ohne zu stören nach ihren vergessenen Natternkleidern suchen.
Im September würden die von der Komposthitze ausgebrüteten Prinzen und Prinzessinnen schlüpfen und einmal, als sich eine frisch geschlüpfte Natter in ihr Haus verschlängelt hatte, trug sie das zerbrechliche Tierchen in ihrer Hand geborgen zurück zum Kompost, ins unterirdische Lebenslabyrinth.
Ein andermal konnte sie gerade noch ihren Flickenteppich, eine weißbraunschwarz gemusterte Katze, aus erbittertem Kampf mit einer Schlangenkönigin reißen.
Danach, so schien es der Karde, waren beide froh, ohne Gesicht und vielleicht auch ihr Leben zu verlieren, aus diesem Hin- und Hergezucke, wildem Krallenschlagen und verzweifeltem Zubeissen heraus gekommen zu sein. Am meisten die Karde.
Sie mochte den Tod nicht, in keiner Form. In einem früheren Leben hatte sie ihn kennen gelernt. In einem anderen Dorf in einer anderen Zeit unter anderem Namen hatte sie einmal, nur einmal im Leben, Gänse geschlachtet. Das macht man eben so, auf dem Dorf. Und wer Fleisch essen will, der muss eben auch schlachten, so dachte die Frau, die damals noch nicht die Karde war.
Mit dem Schlachten der Gänse war der Tod auf den Hof gekommen; sie erlitt viel Unheil und Leid, war irgendwann getrieben, an einem anderen Platz ein neues Leben anzufangen. So war sie nach beschwerlichen Versuchen hier gelandet.
Die neuen Gänse waren ihr längst das Liebste, gleich neben ihrem Garten. Mit ihnen zog sie jeden Abend den alten Sandweg Richtung Wald. Die Gänseschar fraß sich an den Kräutern des Wegraines satt, griffen hier eine vorwitzige Blüte und zerrten dort an einem widerstrebenden Blatt, waren zufrieden. Setzten sich fünf Minuten, kuschelten ihre gelben Flaumkleider aneinander, plauderten, schlossen die Augen, genossen den behüteten Moment. Wie die Karde.
Zu den Dorfleuten war sie freundlich, aber distanziert. Nachdem sie im Lauf des Sommers einigen übermütigen Junggesellen deutlich gemacht hatte, dass sie keine Hilfe benötige, allein zu recht komme, gut und gerne sogar, ohne Mann an ihrer Seite, wechselt ihr Spitzname unter den Dörflern. Aus der spöttischen „Gänseliesl“ wurde die „wilde Karde“.
Kratzbürstig schien sie, wie die Karde, eine ihrer Lieblingspflanzen. Nach allen Seiten stachelbewehrt der harte hohe Stengel, wehrhafter Stachelsaum an den Rippen lanzenförmiger Blätter und etwas weniger harte Borsten um eiförmige Blütenstände.
Die Blütenstände ganz oben, zusätzlich geschützt durch einen Rundumbart stachelspitzer Kelchblätter. Ein Wunder, wie diese wehrhafte Pflanze so zarte blauviolette Blütenkreise bilden konnte.
Immer zwei, drei, selten vier Blütenringe, die gemeinsam im Blütenstand verblühten und denen sich die nächsten blauvioletten Ringe nach unten oder nach oben anschlossen.
Wer genau hinsah, konnte bereits die ungeduldig ihren großen Auftritt herbei sehnenden nächsten Blütenringe in den Knospen erahnen. Sollte sich selbst diese kratzbürstige Stachelpflanze kleine Eitelkeiten gönnen?
Eine Hummelpflanze, die mit ihrem Nektar sämtliche Brummer, ob mit orangenem Hintern, mit weiß-orange-schwarz, weiß-orange-weiß gezeichnetem Hinterleib oder samtpelzig orange überhauchten Hummeln, zu Tisch bat.
Eine Pflanze, die in ihren Blattachseln vorsorgend Regen hortete. Tränke für Notzeiten. Für die Karde, Vögel und durstige Insekten. Widersprüchliche Pflanze, liebenswert in stachelstrotzender Wehr.
Zugegeben, ein wenig wild wirkte die Karde. Groß gewachsen, dabei nicht zu lang. Weizenblondes glattes Haar, blaue stechende Augen, nicht dünn, nicht dick, stets gleich gekleidet: Arbeitsschuhe, Kordhose, einfarbiges Hemd und manchmal schwarze Schiebermütze in der Stirn. Bei Regen ein blauer Poncho darüber, bei Sonnenschein Ärmel hoch gekrempelt, dann und wann die Hosen gleich dazu. Im Sommer barfuß.
Eines Abends, im ausgehenden Juli, hütete die Karde ihre Gänse an der Wegböschung unweit des Dorfes Richtung Wald. Wie jeden Abend. Ruhte tagesmüde im lichten Schatten des korkrindigen Feldahorns, ein Auge auf ihren Schutzbefohlenen, lauschte dem Plapperlaplapp und reiste halbwach durch Traumwelten.
Mag sein, dass sie durch lichte grünverzauberte Wälder wehte, zu einer Quelle, an einen Bach, einen See. Vielleicht wanderte sie an ganz anderen Orten.
Ob sie dabei mit Pflanzen geredet hat, mit Wesen, die dem gewöhnlichen Menschenauge verborgen bleiben? Ob sie Gedanken mit Tieren tauschen konnte? Dem Schwanenpaar zu seinem Nachwuchs gratulierte, den Kranichjungen, die sie an ihre Gössel erinnerten, dringend empfahl, nie zu spielen, jeden Moment hellwach zu leben, immer immer immer auf der Hut zu sein? Das weiß die Karde allein.
Auf einem ihrer Traumpfade zuckt ein blondes Blitzen aus der Ahornkrone, verwoben im Klang, und da steht er. Wie jedes Mal – aus dem Nichts. Ein ehemals weißes verschwitztes Hemd, altmodisch am Kragen geschnürt, knöchellange hellbraune Hose, schuhlos, schmalrandiger Strohhut auf dem Kopf. Ein Sonnenstrahl im goldenen Ohrring.
Die Karde schreckt auf,. will hochspringen, losrennen, weg, nur weg… Dann bindet sie dieser wundersame Ton. Gebannt vom Klangzauber, noch immer aus schreckstarren blauen Kardenaugen, blickt sie sich um. Notiert wie aus weiter Ferne, dass ihre sonst so schreckhaften Gänschen seelenruhig weiter auf dem Rain weiden.
Alle, außer einem. Das starrt mit offenem Schnabel auf den Fremden und scheint mit schiefem Kopf dem Klang zu lauschen. Die Karde kommt zu sich, wendet sich endlich entschlossen um, dem Fremden ins Gesicht zu blicken.
Als ob sie in gleißende Sonne sieht. Wie durch Flammen hört sie seine Stimme: „Ich bin auf dem langen Weg nach Dubrow, hungrig und bitte um ein kleines Stückchen Brot als Wegzehrung.“ Was für ein Klang die Karde umwehte, berührte, ausfüllte.
Gefangen im Augenblicks, wendet sie sich mechanisch um, greift noch immer sonnenblind in ihr Bündel, drückt ihm ihren Kanten Brot und eine Zwiebel in die harte Hand.
Knapper Dank, Wünsche für Glück, schon dreht er sich mit einem plötzlich aufkommenden Staubwirbel und ist: Verschwunden.
Die Karde fiel erschöpft auf den Wegrand. Alles in ihr war Drehung, selbst der Klang schien sie wie ein Kreisel mit sich zu wirbeln. Wach bleiben, um Himmels Willen: Wach bleiben. Jeder Moment dieser Begegnung wollte in Bilder gekleidet, in Erinnerung gerufen werden. Aufgewühlt begann sie: „Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gehört? Diesen goldenen Klang? Ein Zauber. Oder nur ein Traum?“
Die Gössel zupften unbeeindruckt weiter Gras, plapperten, dösten aneinandergekuschelt wenige Augenblicke und wollten erneut ihren Reigen leben.
Einzig das Gänschen, das zuvor dem Klang gelauscht hatte, kam zur Karde, schmiegte sich dicht an sie und plauderte selbst versunken. Es war, als ob der Klang durch dieses Geplauder neue Kraft schöpfte und die Karde erfüllte.
Doppelglück. Der goldene Klang hatte ihre Herzen verändert und strahlte aus blauen Augenpaaren. Hatte das Gänschen gerade dasselbe erlebt wie sie? Oder alles doch nur ein Hitzestreich?
Nein: Niemals zuvor hatte ein Gänschen den Kreis der Schwestern verlassen und sich an sie geschmiegt. Das war, konnte kein Zufall sein.
Der Klang, dieser Klang! Jetzt, warum erst jetzt, fiel es ihr ein: Der goldene Klang. Von ihm hatte sie gelesen. Im vergangenen Winter in den Sagen der Uckermark. Gelesen und wieder vergessen, bis gerade eben. Die Sage beschrieb ja, wie Menschen, die dem Streicher begegneten, immer erst danach merkten, mit wem sie zu tun hatten.
Der Abend begann, sich in der Nacht aufzulösen. Hohe Zeit für den Rückweg zum bergenden Hof. Wie jeden Abend. Alles schien, wie immer. Die Gössel watschelten hoch aufgerichtet in ihren Stall, tranken noch einen Schluck Wasser, Köpfchen in die Höh und hatten sich zum Flaumkuchen zusammen gefunden, der sich lispelnd in den Schlaf summte.
Nur nicht die kleine Gans. Sie lief mit ins Haus, strampelte sich die Stufen hoch und folgte der Frau bis in den Schlaf.
Immer, wenn diese beiden zusammen waren, von dieser Stunde an, schwoll der goldene Klang in ihnen wie ein aufkommender Sturm, der sich noch rasch in wiegenden Kiefernwipfeln kämmte, allmählich an. Wie sie dieses Rauschen liebten, ihre Begegnung mit dem Streicher dabei jedes Mal neu lebten.
Menschen, die der Karde von nun an begegneten, waren verblüfft. War das die alte Karde? Mit dem nun leuchtenden Blick, offenen Zügen, zugewandten Worten? Nach jeder Begegnung glomm in in den Augen der Menschen ein kleines Strahlen, ein leichtes Lächeln und im Innersten wehte ein wundersamer Klang.
Die Dörfler, die die Karde gemieden, sich lustig gemacht und vielleicht sogar ein wenig Angst vor ihr hatten, suchten von nun an ihre Gesellschaft. Auf einem Dorffest, beim Einkauf, einem kurzen Plausch über den Holzzaun und so wurde die Karde eine von ihnen. Nein, keine von ihnen, aber sie schien dazuzugehören. Zum ersten Mal. Auf ihre Art.
Bald hatte es sich herum gesprochen, dass sie eine Pflanzenfreundin war, eine Heilerin. Einige sagten, sie hätten das schon immer geahnt. Wozu sonst hätten all die sonderbaren Blumen in ihrem Garten dienen sollen. Einigte flüsterten, sie hätten gehört, wie sie sogar mit ihren Gartenpflanzen sprechen würde. Und einer will sie neulich unter der einzel stehenden Weide am Wegkreuz beobachtet und Stimmen gehört haben. Obwohl weit und breit keine andere Menschenseele war.
Von nun an suchten Dorfmenschen die Karde auf und baten bei Krankheit um Rat. Die Karde verschloss sich nie.
Die Dörfler wunderten sich, dass im Umfeld der Karde stets eine große strahlend weiße Gans war, meist ein wenig verträumt. Nur wenn ein Mensch zu lange blieb, zuviel redete, immer mehr fragte, wurde sie unruhig. Dann konntes es schon einmal passieren, dass sie ihr Gefieder schüttelte, sich mit langem Hals zischend auf den Redner zumachte und das war jedes Mal das Signal zum Aufbruch. Wenn es der Gast nicht verstehen wollte, dann verstand die Frau.
Ein letztes Mal wechselte die Karde ihren Namen. Aus der wilden Karde wurde in den Gesprächen der Dörflern die Heilkarde. Und das sollte so bleiben. Solange sie in ihrem kleinen Häuschen irgendwo in einem verborgenen Winkel der Uckermark lebt.
Bibliographie
2022 „Die Hüterin des Stolper Turmhügels“, 312 S.
ISBN 9783756273973
2019 „Wildes Leben am großen Strom“, 296 S.
ISBN 978-3946815181
2017 „Grumsin – Weltnaturerbe“ als Koautor, 168 S.
ISBN 978-3-942062-20-6
2014 „Mein Grumsin“, 170 S.; R. Schulz, ohne ISBN
2012 „Der Grumsin“, Geisel-Luthardt-Schulz, 183 S.
ISBN 978-3-943487-00-8
2004 „Buchenwald im Wandel der Zeit“, Luthardt- Schulz-Wulf, 134 S.
ISBN 13: 9783980762779